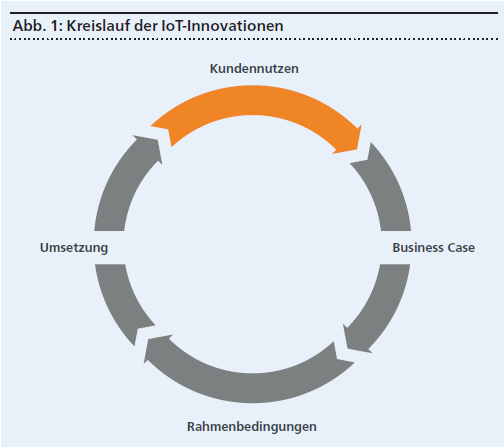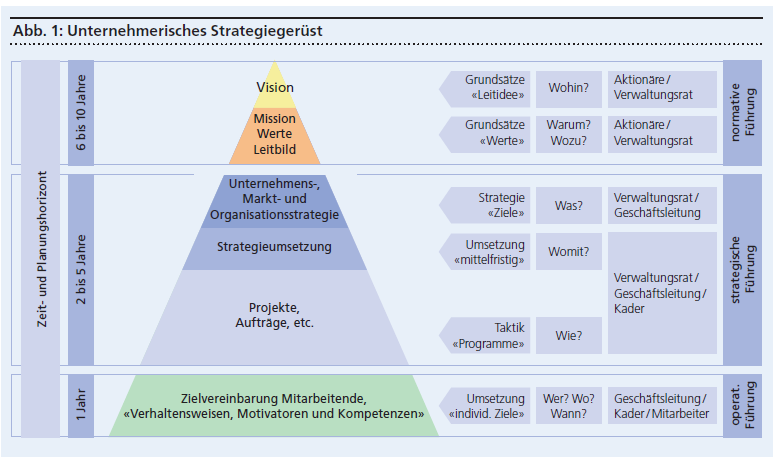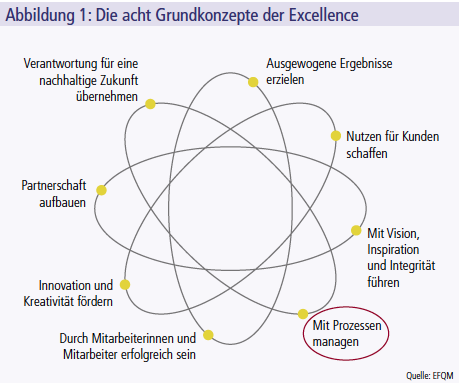Das unternehmerische Umfeld des 21. Jahrhunderts ist durch einen ununterbrochenen Wandel geprägt. Aufgrund der exponentiellen Dynamik der Märkte, der zunehmenden Globalisierung, Verkürzung der Produktlebens- und Technologiezyklen sowie der Entwicklung komplexerer Produkte gelingt es heutzutage nur wenigen Unternehmen, sich mittels innovativer Produkte und effizienter Prozesse von der Konkurrenz abzugrenzen (Cooper 2002). Viele Produkte scheitern am Markt, sind zu teuer oder kommen zu spät. Die Prozessoptimierung, die darauf zielt, die Effizienz bestehender Geschäfts-, Produktions- und Entwicklungsprozesse sowie den Einsatz der hierfür benötigten Ressourcen kontinuierlich zu erhöhen, ist heute unverzichtbarer Bestandteil jeder modernen Betriebsführung.
Werte ohne Verschwendung
So dient das Lean Management als eine permanente, konsequente und integrierte Anwendung mehrerer Methoden, Prinzipien und Massnahmen zur effektiven und effizienten Planung, Gestaltung und Kontrolle der Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Ziel dabei ist es, Verschwendungen zu vermeiden und somit eine schlanke Betriebsführung umzusetzen (Pfeiffer/Weiss 1994). Sowohl in der unternehmerischen Praxis als auch in der wissenschaftlichen Forschung besteht ein grosses interdisziplinäres Interesse, herauszufinden, welche Vorgehensweisen und Methoden den Grundsatz «Werte ohne Verschwendung schaffen» bestimmen. Lassen sich Unternehmensprozesse nach den Lean-Prinzipien ausrichten, so kann Verschwendung vermieden, zugleich Flexibilität erreicht und damit der wirtschaftliche Erfolg nachhaltig gesichert werden. Die Anwendung der Lean-Prinzipien erlaubt der Unternehmung, ihre Produkte und Prozesse erfolgreicher und profitabler zu gestalten, um in Zukunft den Wettbewerbern den entscheidenden Schritt voraus zu sein. Der Schlüssel zum Erfolg ist nicht die einmalige Einführung eines Lean-Konzeptes, sondern die Integration der drei Subsysteme Prozesse, Menschen und Methoden. Nur durch Interaktionen innerhalb und zwischen diesen Subsystemen wird ein direkter Einfluss auf die Zielerreichung jeder Organisation ermöglicht. Anhand von «Best Practices» aus führenden Unternehmen können KMU die eigene Position in punkto Lean Management analysieren und ggf. Massnahmen ergreifen. Auf diese Weise können KMU feststellen, ob sie bereits im Sinne der Lean-Prinzipien handeln, bewusst oder unbewusst.