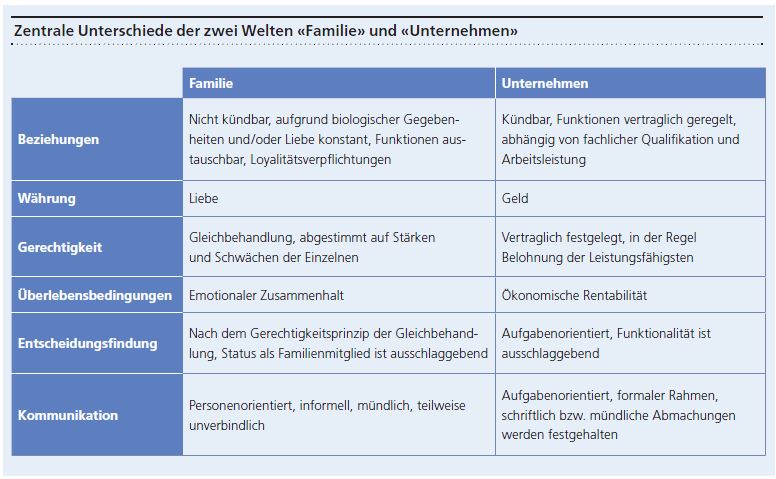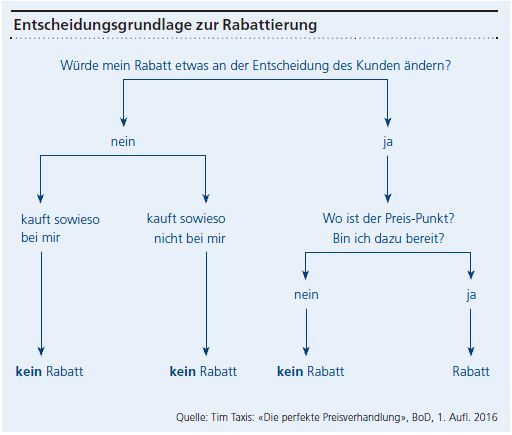Weltweit sind 50 Millionen organische Verbindungen im Wasser im Umlauf, von denen 5000 als potenziell umweltgefährdend eingestuft werden. Die Gewässer in Industrienationen sind mit Mikroschadstoffen wie Arzneimittelrückständen, Pflanzenschutzmitteln oder Schwermetallen belastet, die schwer abbaubar sind und trotz ihrer geringen Konzentration teilweise toxisch wirken. Inzwischen steigt die Resistenz vieler Krankheitserreger und Bakterien gegen wichtige Wirkstoffe wie Antibiotika, weil diese über die Ausscheidungen des Menschen und den Wasserkreislauf wieder ins Trinkwasser geraten. Auch Tiere sind von diesem Problem betroffen, z. B. Fische.
Aktivkohle als Bindemittel
Schon in den 1980er-Jahren hat man nach Möglichkeiten gesucht, um Medikamentenrückstände sowie Hormone aus dem Abwasser zu entfernen. In den letzten Jahren hat man Verfahren dafür entwickelt, vor allem mit Aktivkohle, die schon seit längerer Zeit zur Wasserreinigung verwendet wird. Neu ist das deutsche Verbundprojekt «Zero Trace», das am 1. Februar 2017 gestartet und auf eine Laufzeit von drei Jahren angelegt ist. Das Projekt wird vom Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik «Umsicht» unter der Projektleitung des Wupperverbands mit anderen Partnern durchgeführt und vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung durch den Projektträger Jülich gefördert.
Um Mikroschadstoffe wie Arzneimittelrückstände aus Abwasser zu eliminieren, kommen häufig Aktivkohlefilter zum Einsatz, die die organischen Stoffe an ihrer Oberfläche binden. Die Kohlebestandteile sind aus nur begrenzt verfügbarer Steinkohle, die nach dem Bindungsprozess speziell entsorgt, regeneriert oder in Verbrennungsanlagen vernichtet wird. Die Regeneration der Aktivkohle erfordert einen hohen energetischen und logistischen Aufwand. Im Projekt «ZeroTrace» will man Aktivkohlen entwickeln, die aus regenerativen Rohstoffen wie Kokosnussschalen hergestellt werden und in grossen Mengen preiswert zur Verfügung stünden.
Beim Auftakttreffen des «ZeroTrace»-Konsortiums am 21. Februar 2017 waren sich die beteiligten Fachleute einig, dass nach aktuellem Erkenntnisstand Aktivkohle in der Mikroschadstoff-Eliminierung langfristig nicht ersetzbar ist. So planen die Bundesanstalt für Materialprüfung und -forschung sowie Evers Wassertechnik und Anthrazitveredelung, Aktivkohle als Komposit herzustellen. Gemeinsam mit Enviro Chemie wird Fraunhofer «Umsicht» ein Verfahren auf Basis von «Electric Field Swing Adsorption» (EFSA) entwickeln, mit dem sich Aktivkohle vor Ort regenerieren lässt, statt sie unter grossem Aufwand zu einer zentralen Verbrennungsanlage zu fahren.
Das neue Verfahren soll die Wärme zum Ausbrennen der Aktivkohle elektrisch erzeugen: Der Aktivkohle werden elektrisch leitende Materialien wie Grafit zugefügt. Je elektrisch leitfähiger die Aktivkohle ist, desto besser erwärmt sie sich und desto vollständiger werden die Mikroschadstoffe in der Regeneration wieder abgelöst. Der gesamte Prozess soll schliesslich von Enviro Chemie anlagentechnisch umgesetzt und auf zwei Kläranlagen des Wupperverbands unter realen Bedingungen demonstriert werden. Zudem soll das Institut für Ressourcenmanagement Inter 3 erstmalig die Entwicklung neuer Aktivkohlematerialien und -verfahren im Rahmen einer Multi-Kriterien-Analyse untersuchen.
Neue Techniken in der Schweiz
Auch in der Schweiz werden die neuen Möglichkeiten genutzt, um die Spurenstoffe in den Gewässern zu entfernen. In Dübendorf (ZH) hat 2014 eine zusätzliche Klärstufe zur Behandlung von Mikroverunreinigungen ihren Betrieb aufgenommen. Die ARA Neugut ist die erste von rund 100 kommunalen Kläranlagen, die in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Um die nötigen finanziellen Mittel effizient einzusetzen, sollen gemäss Beschluss des Parlaments nur die wichtigsten Anlagen, die zusammen über die Hälfte des gesamten Abwassers in der Schweiz reinigen, aufgerüstet werden. Das wird in den kommenden 20 Jahren total 1,2 Mrd. CHF kosten. Finanziert wird das Projekt hauptsächlich über eine bei allen Abwasserreinigungsanlagen (ARA) erhobene Abwasserabgabe von maximal 9 Franken pro Kopf und Jahr.
Eawag und Empa erforschen zusammen mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft zukünftige Wohn- und Arbeitsformen, neue Konstruktionsmethoden und energieeffiziente Technologien. Im Projekt «Water Hub» geht es um die Frage, wie man mit Trenntoiletten Wasser sparen und Nährstoffe aus dem Urin zurückgewinnen kann. Die deutsche Firma Duravit hat die Toiletten in Zusammenarbeit mit der Eawag und weiteren Firmen entwickelt.