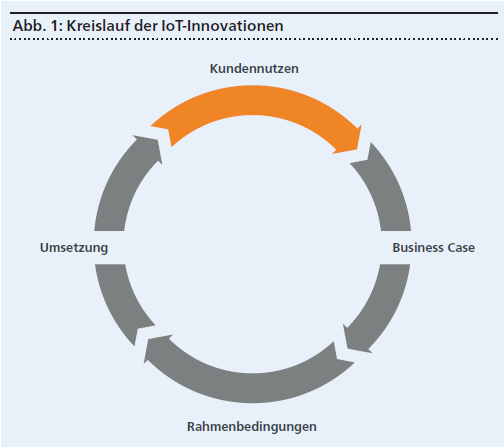Grossbritanniens Entscheid, der EU den Rücken zu kehren, hat ein politisches und wirtschaftliches Erdbeben ausgelöst. Die Börsen und Wechselkurse warteten mit ihren Reaktionen nicht einmal bis zur offiziellen Verkündigung des Abstimmungsresultats, sondern reagierten nur schon aufgrund der Hochrechnungen. Die Börse vernichtete Milliarden, und der ohnehin starke Schweizerfranken legte nochmals zu, von der Abwertung des britischen Pfundes gar nicht zu sprechen. Zeitgleich trat eine Unzahl von Experten ans Tageslicht, alle bestückt mit dem Wissen, wie sich Europa und die Welt in den folgenden Jahren entwickeln werde. Die Prognosen sind so unterschiedlich, dass ein kleiner Teil der Experten mit Sicherheit ins Schwarze treffen wird.
Prognosen
Um die folgenden Verhandlungsempfehlungen in Angriff nehmen zu können, bräuchte es freilich keinen Brexit. Mit ihm ist die Drohkulisse nun aber so hoch, dass es legitim ist, eingespielte Verhaltensweisen, wie und mit wem in der Regel verhandelt wird, zu überdenken. Wer verhandelt, sollte sich bei der Vorbereitung und Zielsetzung möglichst auf Fakten und nicht auf Spekulationen stützen.
Wer sich auf das theoretische Zukunftsszenario eines Experten verlässt und sich im Detail darauf ausrichtet, spielt Roulette. An der Berkely-Universität wurden 82 361 Vorhersagen von 284 Experten über einen Zeitraum von zehn Jahren analysiert. Die Erkenntnisse daraus sind mehr als ernüchternd: Die Trefferquote war kaum besser, als wenn man die Prognosen mit einem Zufallsgenerator erstellt hätte. Wie die Zukunft auch immer aussehen mag und welche Experten mit ihren Prognosen postum Recht erhalten werden, für bevorstehende Verhandlungen gibt es einen kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner, auf den man sich wird abstützen können.
Es ist anzunehmen, dass der Schweizer Franken, in welcher Ausprägung auch immer, tendenziell stark bleiben wird. Es sind bei Weitem nicht nur die exportorientierten KMU betroffen. Im Dienstleistungssektor wie auch in der auf den Schweizer Markt spezialisierten Produktion wird die Konkurrenz aus dem Ausland zunehmen. Die Unsicherheit, ob und wie die Schweiz eine Lösung mit Brüssel finden wird, bleibt vorerst bestehen.
Die vielen Experten mit höchst unterschiedlichen und immer wieder wechselnden Prognosen werden, in unterschiedlicher Ausprägung, Einfluss auf das Verhalten von Schweizer KMU haben. Die Dynamik im Markt nimmt entsprechend zu und die Verlässlichkeit ab.
Eine Lösung, die in absehbarer Zeit (in den kommenden fünf Jahren) greifen könnte, ist nicht in Sicht. Und selbst wenn, würden die aktuellen, enormen Herausforderungen durch neue ersetzt. Unsicherheit, Wandel und Druck bleiben Programm.
Eine starke Hand auf nationaler Ebene, die aus der Krise führt, sei dies in der Politik, Regierung, bei den Behörden, Verbänden oder Interessensgemeinschaften, ist nicht in Sicht. Pragmatisch gesehen gilt wie so oft die Devise: Verlass dich auf dich, sonst bist du ganz verlassen.