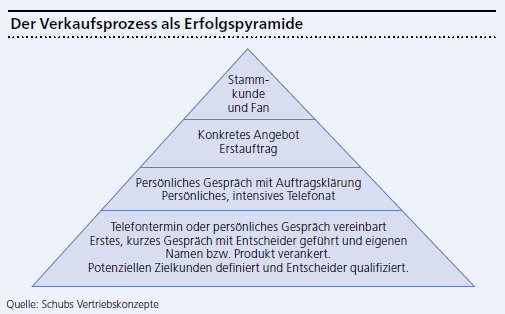Die Schweizer Wirtschaft besteht zu einem grossen Teil aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Mit einem Anteil von 99,6 Prozent aller Unternehmen in der Schweiz und mit einem Beschäftigtenanteil von 66,6 Prozent sind sie das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Der folgende Beitrag will über den aktuellen Internationalisierungsstand der KMU-Landschaft informieren und Tipps für den erfolgreichen Weg zur Internationalisierung geben sowie über mögliche Hindernisse aufklären. Nicht zuletzt werden attraktive Märkte und Branchen beleuchtet, die man als Unternehmen mit internationaler Ausrichtung heute und in Zukunft im Visier haben sollte.
Reaktive und proaktive Gründe
Der Schritt zur Internationalisierung ist für viele Unternehmen in erster Linie eine Reaktion auf Umstände, die mit Zielen verknüpft sind. Dazu zählen unter anderem die Erfordernis oder Chance der Verkaufssteigerung, die Kundenannäherung in ausländischen Märkten, die Senkung von Produktions- und Arbeitskosten oder aber die Kompensation für die Sättigung oder den Rückgang im heimischen Markt.
Es gibt jedoch ebenso zahlreiche proaktive Gründe, Internationalisierung in die Wettbewerbsstrategie – auch und gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen – zu integrieren (siehe Abbildung Seite 34).
Mit einer Internationalisierung können Unternehmen
- die Entwicklung und das Wachstum anderer Märkte für sich nutzen.
- Teile der Wertschöpfungskette in wettbewerbsfähigere Regionen verlagern – sei es eine Verlagerung des Standorts in Länder mit geringeren Produktions- und Lohnkosten oder eine Auslagerung verschiedener Prozesse vom Kundendienst bis hin zu Call-Center für Forschung und Innovation.
- Skaleneffekte und Reichweiten nutzen.
- Wichtige Informationen zu anderen Kunden und Märkten, globalen Kapazitäten der Mitbewerber in einer bestimmten Industrie oder einem bestimmten Sektor und sogar zur kulturellen Vielfalt von Teams in globalen Unternehmen gewinnen.
Das Argument der Informationsgewinnung wird in der Literatur häufig vernachlässigt. Dennoch ist es von grundlegender Wichtigkeit, da Unternehmen, die nicht international aufgestellt sind, genau deshalb weniger wettbewerbsfähig und angreifbarer sind. Unternehmen müssen im Ausland tätig sein und sich dem internationalen Vergleich stellen.
Im Allgemeinen wird Internationalisierung häufig mit Big Business in globalem Ausmass gleichgesetzt, allerdings können sich auch KMU mit begrenzten Mitteln internationalisieren, wenn sie gewisse Grundregeln beachten.