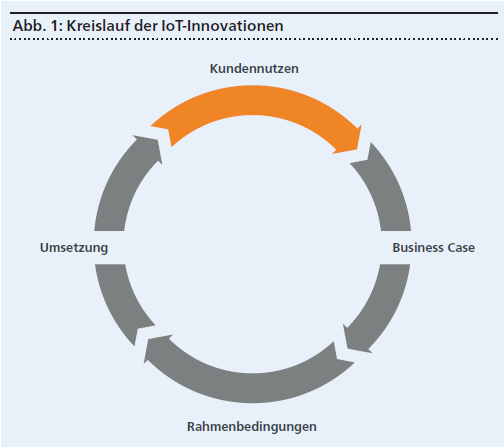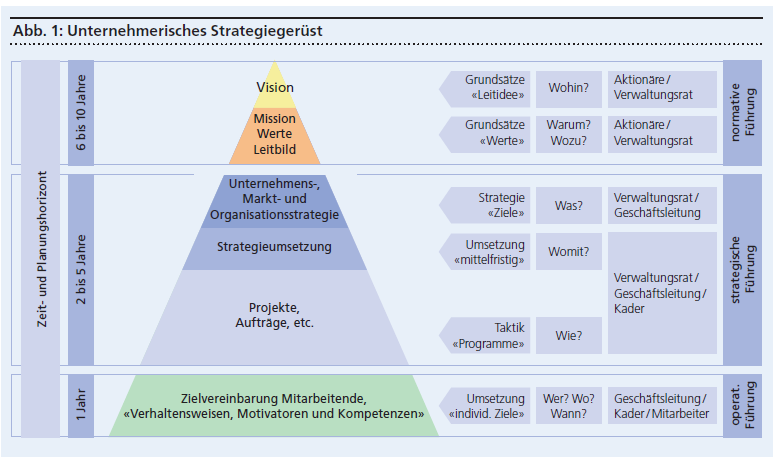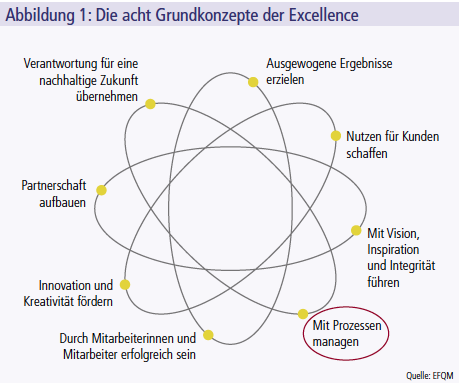China ist ein Markt, der grosse Hoffnungen weckt und zur gleichen Zeit grosse Hindernisse bereithält. Wer blind in Geschäftsverhandlungen einsteigt, erlebt häufig Enttäuschungen. Ein Beispiel hierfür: Ein Finanzinstitut in der Schweiz plant die Markteinführung eines neuen Produkts auf dem chinesischen Markt. Sabine, eine Schweizer Business-Managerin, zuständig für den chinesischen Markt aus Hong-Kong, leitet die Projektorganisation. Sie soll Regierungsvertreter, Regulatoren und Schweizer Manager der Hong-Konger Niederlassung der Bank an einen Tisch bringen. Die Verhandlungen über die Produkteinführung gestalten sich zäh.
Im Verlaufe der Konferenzschaltungen scheint es Übereinkünfte zu geben, die zwar nicht ausdrücklich sind, aber auch nicht explizit abgelehnt werden. Die konkreten und detaillierten Umsetzungsschritte, die Sabine ausarbeitet, werden jedoch von chinesischer Seite nicht eingehalten. Für Sabine wird es zunehmend schwieriger, Zwischenziele einzuhalten. Sie fühlt sich von den Schweizer Managern mehr und mehr unter Druck gesetzt, da diese eine korrekte Einhaltung der Abmachungen fordern. Die chinesischen Vertreter wiederum reagieren nach einiger Zeit weder auf E-Mail- noch auf telefonische Anfragen. Das strategisch überaus wichtige Projekt droht zu scheitern.
Kulturbedingte Unterschiede
Solche und ähnliche Situationen habe ich in meiner Rolle als Business-Managerin für die Region Greater China in einer Schweizer Grossbank erlebt. Vielleicht haben sich einige andere global tätige Projektverantwortliche bei der Lektüre dieses Fallbeispiels ebenfalls mit ähnlichen Erfahrungen wiedergefunden. Für mich war es damals zentral, herauszufinden, welche Faktoren zu den Missverständnissen und der letztendlichen Eskalation einer solchen Situation beitragen konnten.
Ein grundlegendes Element interkultureller Zusammenarbeit ist das unterschiedliche Sozial- und Kommunikationsverhalten in verschiedenen Kulturen. Durch die Zusammenarbeit mit ostasiatischen Kolleginnen und Kollegen, die in der Schweiz arbeiteten, war mir bereits bewusst, wie wichtig das familiäre und soziale Umfeld als Grundlage ihrer Entscheidungen und auch ihrer Kommunikation war. Ich habe es selbst sehr geschätzt, als Teil ihrer Gruppe privat eingeladen zu werden und auch über das Geschäft hinaus Zeit mit ihnen und ihren Familien verbringen zu können. Eine Einbindung in für mich als privat wahrgenommene Lebensbereiche der Arbeitskollegen beruhte jedoch nicht nur auf der freundschaftlichen Verbundenheit Einzelner. Es war auch ein wichtiger Bestandteil asiatischer Geschäftskultur. Das wurde mir erst bewusst, als ich für die gleiche Firma beruflich in Hong-Kong eingesetzt wurde.