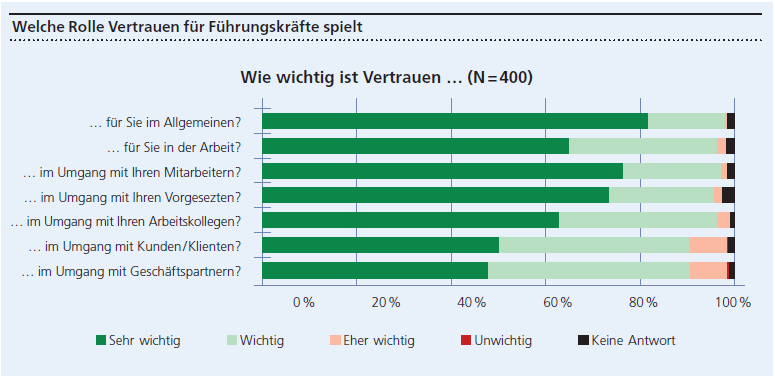These 2: Fassbare Faktoren entscheiden die Zusammenarbeit.
Die Forschungsgruppe fragte auch die Verstärker für Kooperation ab. Welche Faktoren sind im Führungskräftealltag wichtig, damit vertraut wird? Bei den Ergebnissen finden sich Klassiker der Führungslehre wie Sympathie und Gemeinsamkeiten, das Vorliegen persönlicher Informationen und fachbezogene Berufserfahrung. Dies sind alles bekannte Teamworkverstärker. Es gibt jedoch auch überraschende Erkenntnisse: Hierarchie und Seniorität wirken demnach kontraproduktiv, vor allem wenn dies der beherrschende Faktor der Zusammenarbeit ist.
Im Einzelnen erwarten 70 Prozent der Befragten von einer Person, welche sie sympathisch finden, mehr Kooperation. Sympathie ist vor allem bei jüngeren Mitarbeitern unter 40 ein höchst wichtiger Faktor, während ältere Mitarbeiter hier ganz stark differenzieren. Über 60-jährige Mitarbeiter vertrauen nur noch zu 40 Prozent. Dies erweckt den Anschein, als ob sich Vertrauen manchmal über längere Frist aufbrauchen würde.
Berufsbezogene Erfahrung und das Mitteilen von persönlichen Informationen (Hobbys, Familie und Interessen) – um Gemeinsamkeiten und Sympathie zu schaffen – haben einen stark positiven Einfluss auf das Vertrauensniveau. Dies gaben 60 Prozent der Befragten an. Überraschend ist allerdings, dass berufliche Stationen in renommierten Unternehmen weit weniger ins Gewicht fallen, was das Vertrauen in Teamwork und Kooperation betrifft. Diese Information ist nur für zirka 20 Prozent der Befragten wichtig und kann sogar zu negativen Effekten führen.
Was bedeuten die Ergebnisse für die Managementpraxis? Die klassischen Sympathietreiber (wie etwa die Betonung gemeinsamer Interessen) sollen an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden. Jedoch ist es wichtig, dass tatsächlich über alle wesentlichen Kanäle der Kommunikation auch die oben genannten Sympathietreiber und persönlichen Informationen bereitgestellt werden. Kommt dies zu kurz, wird die Schnittmenge der möglichen Gemeinsamkeiten kleiner und das Vertrauen kann weniger wachsen. Andere polarisierende Informationen sollten eher in den Hintergrund treten. Hier sind insbesondere das Plädieren auf das Renommee bisheriger Stationen, die Hierarchieebene und die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit zu nennen.
Der Arbeitsalltag ist kein Bewerbungsgespräch mehr, sondern ein dauerhaftes, situatives und reflektiertes Streben nach Vertrauen, Sympathie und erfolgreichem Teamwork.
These 3: Alle sind gleich und manche sind gleicher.
Eine weitere Herausforderung des Manageralltags ergibt sich nicht nur beim Aufbau von Vertrauenskapital, sondern auch aus dem Ringen um praktische Kooperation und dem Einbringen der Leistung in ein soziales Gefüge. Bei dieser Interaktion bildet das Gewähren eines Vertrauensvorschusses eine entscheidende Rolle.
Während 20 Prozent der befragten Führungskräfte grundsätzlich in allen Fällen kooperieren (dominante Verhaltensart A) – also vertrauensvoll und gutwillig handeln – agiert der Hauptteil absolut strategisch. Viele kalkulieren ihren eigenen Nutzen und Aufwand in die zukünftige Kooperation ein. Hierbei zeigen die empirischen Ergebnisse der Studie auf, dass an dieser Stelle grundsätzlich zwei unterschiedliche Verhaltensarten auftreten: Typus B wartet immer erst mit der Kooperation ab, bis der andere sich proaktiv zeigt, also kooperiert. Typus C leistet in allen Fällen genauso viel an Teamwork wie der andere auch.
Beispielhaft bedeutet dies in etwa Folgendes. Wenn ein Team mit zehn Mitarbeitern im Sitzungszimmer sitzt und gerade ein Projekt begonnen wird, werden etwa sieben Projektmitglieder immer zuerst nichts tun und abwarten, ob und wie sich die anderen Mitglieder engagieren. Lediglich zwei werden – unabhängig von den Reaktionen der anderen – ihre Leistung für das Team erbringen. Der Rest besteht entweder aus grundsätzlichen Kooperationsverweigerern – zirka zehn Prozent haben bereits mental gekündigt – oder Menschen, welche andere Prioritäten haben. Aus praktischer Erfahrung heraus ist diese Konstellation Führungskräften sicherlich bekannt, durch die Studie ist sie jetzt auch empirisch belegt.
Dies zeigt jedoch zugleich, dass eben das klassische Bestreben der Führungskraft um Vertrauen und Sympathie alleine nicht ausreicht. Erfolgreiches Teamwork funktioniert ab einem gewissen Punkt nicht mehr, wenn das Vertrauen dadurch erschöpft wurde, dass es zu oft missbraucht wurde.
Daraus resultieren für Manager folgende Handlungsimplikationen: Im Idealfall geht die Führungskraft voran und setzt sich in der ersten Phase des Projektes proaktiv ein. Dies gibt ein hohes Niveau an Vertrauen vor und zieht die anderen Mitglieder auf das entsprechende Kooperationsniveau. Kooperation als Grundhaltung zahlt sich allerdings aus. Fast zwei Drittel derjenigen, die nicht automatisch kooperieren, reagieren auf Zeichen von Teamwork mit eigener Kooperation. Der Vertrauensvorschuss trägt in diesem Fall Früchte.
Dennoch gibt es auch Kooperationsverweigerer, bei denen sogar dieses Verhalten nicht zu einem gewünschten Ergeb-nis führt. Mit einem empirisch belegten 25-Prozent-Chancenanteil begegnet man ihnen – und zwar auf jeder Hierarchieebene. Hier wirken Kommunikation und Sympathie nur eingeschränkt. Eher ist auf handlungsauslösende Massnahmen zu setzen, wie Informations- und Kommunikationssysteme, wie auch Entlohnungs- und Bewertungssysteme, die Mitarbeiter honorieren, welche immer kooperieren oder proaktiv sind. Der Nutzen der Kooperation für den Mitarbeiter im Projekt muss sich «lohnen». Auch spielt hierbei die Unternehmensgrösse eine Rolle. Insbesondere bei kleineren und mittelständischen Unternehmen bis zu 250 Mitarbeitenden ist die Strategie «gleich viel kooperieren wie der andere» deutlich ausgeprägt.