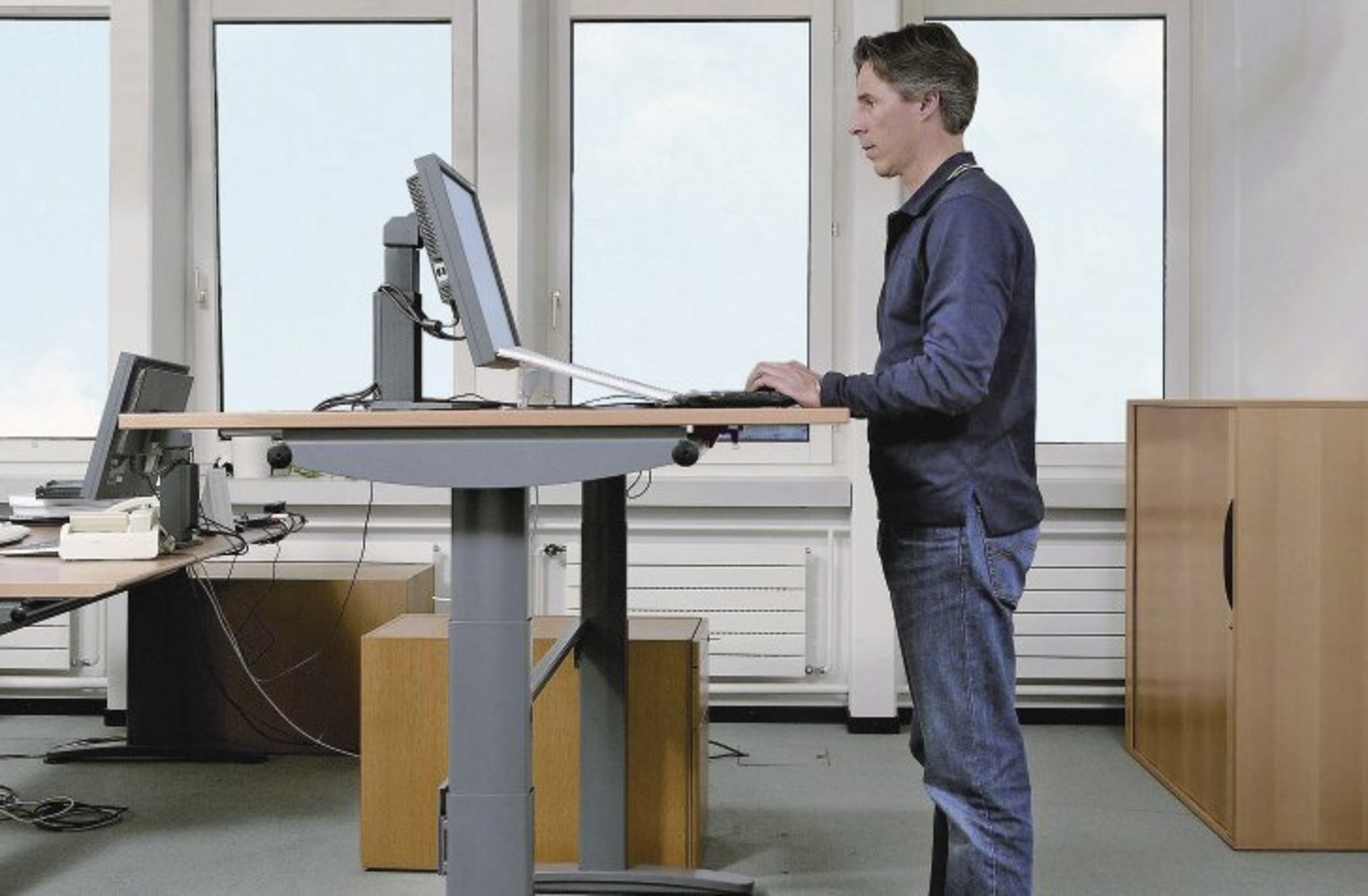Eine verspannte Nackenmuskulatur, Schmerzen in Schulter- und Handgelenken und brennende Augen: An vielen Bildschirmarbeitsplätzen gehören solche Beschwerden zum Alltag. Die häufigsten Ursachen dafür sind ungeeignete Möbel und Arbeitsmittel sowie ergonomisch mangelhaft gestaltete Arbeitsplätze und unsachgemässes Benützen der Arbeitsmittel. Dies kann schmerzhafte Folgen haben, denn jahrelanges Arbeiten auf falscher Höhe, mit hochgezogenen Schultern oder gebeugtem Rücken, führt zu körperlichen Beschwerden.
Mängel kosten Unsummen
Das Seco (Staatssekretariat für Wirtschaft) hat im September 2009 eine Studie veröffentlicht, nach der Beschwerden am Bewegungsapparat in der Schweiz Absenzen mit Folgekosten von fast einer Milliarde Franken verursachen. Personen, die mit Beschwerden weiterarbeiten, bringen zudem eine schlechtere Leistung, was nochmals Kosten von 3,3 Milliarden Franken nach sich zieht. Diese Zahlen sind enorm, erstaunen die Fachleute der Suva allerdings nicht. Gemäss Arbeitsplatz-Abklärungen und Betriebsberatungen dürften rund zwei Drittel aller Arbeitsplätze ergonomische Mängel aufweisen. In der Hälfte dieser Fälle sind die Mängel so gravierend, dass sie Beschwerden verursachen können.
Die Ursachen sind vielfältig. Es beginnt in der Regel beim Einkauf: Wenn die Entscheidung für ein bestimmtes Produkt nur nach Preis oder Aussehen und nicht nach Eignung und Funktionalität getroffen wird, hat man sich unter Umständen einen Auslöser körperlicher Beschwerden zugelegt. Wenn sich beispielsweise ein Bildschirm nicht tief genug absenken lässt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Benutzer irgendwann unter trockenen Augen oder Nackenverspannungen leidet, sehr hoch. Oder wenn eine sehr grosse Person mit dem «Standardstuhl» des Arbeitgebers Vorlieb nehmen muss, den sie nicht hoch genug einstellen kann, wird sie vermutlich irgendwann unter Kreuzschmerzen leiden. Problematisch ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass Einkäufer oder EDV-Fachleute in der Regel nur marginale Ergonomie-Kenntnisse haben. Ausserdem werden viele Produkte mit dem Prädikat «Ergonomie» oder «ergonomisch» angepriesen, ohne die geringsten Anforderungen dafür zu erfüllen.
Ästhetik geht zu oft vor
Eine weitere mögliche Ursache für Beschwerden liegt bei der Gestaltung und Auslegung der Arbeitsräume. Architekten lassen sich oft so stark von ihren ästhetischen Empfindungen und Vorstellungen leiten, dass sie den Hauptzweck, nämlich die Nutzung des Raums, vernachlässigen.
Beispielsweise können grosse Fensterflächen die Augen bei der Bildschirmarbeit durch Blendung oder Reflexionen sehr stark belasten und ermüden. Wenn auf mehr als einer Raumseite Fenster sind, ist das Arbeiten an fensternahen Arbeitsplätzen ohne Blendung oder störende Reflexionen praktisch nur noch mit zusätzlichen Lichtschutzmassnahmen wie Storen, Vorhängen oder Rollos möglich. Das bedeutet wiederum, dass fensterferne Arbeitsplätze unter Umständen künstlich beleuchtet werden müssen.
Aber auch richtig ausgewählte Arbeitsmittel und ein Arbeitsraum mit perfekten Voraussetzungen sind noch keine Garantie für beschwerdefreies Arbeiten. Die Aufstellung oder Anordnung der Arbeitsplätze im Raum und die Gestaltung der Arbeitsplätze selbst bilden weitere mögliche Fehlerquellen, die körperliche Beschwerden auslösen können. Die Leute wissen häufig nicht, wie sie mit ihren Arbeitsmitteln umgehen müssen und oft nehmen die Arbeitgeber ihre diesbezügliche Informationspflicht nicht wahr. Zum Glück lassen sich Anordnungs- und Gestaltungsfehler in den meisten Fällen mit wenig Aufwand und Kosten beheben.