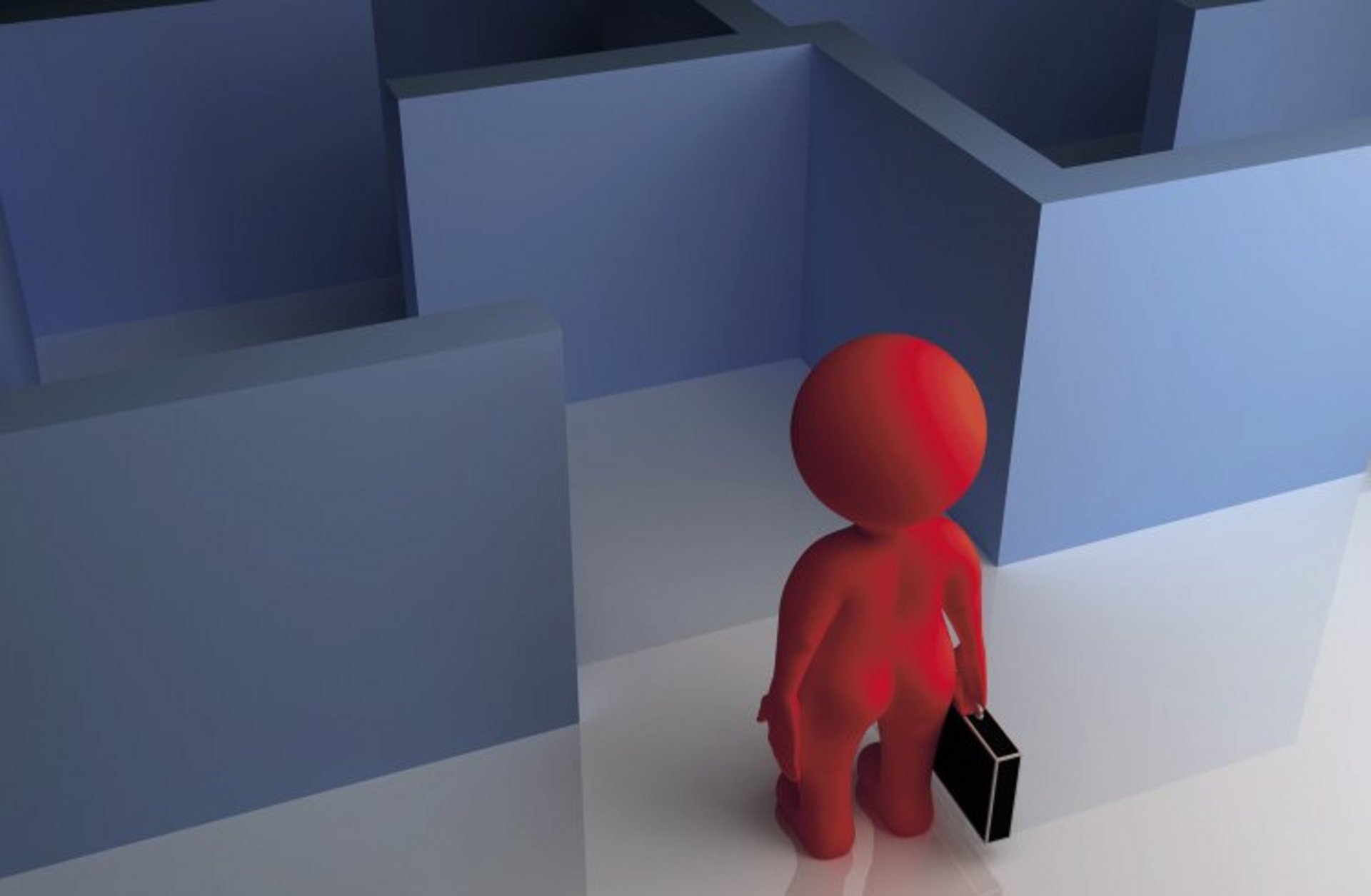Wir haben uns so sehr an die Engführung gewöhnt, dass wir die Frage automatisch quantitativ verstehen: «Wie sehr sind Sie intelligent?» Da wird die eigene Masszahl («Ich habe einen IQ von 126») ins Gespräch geworfen, als ob es um den Vergleich von Bizepsumfang oder Pferdestärken ginge. Im vorliegenden Artikel wird vorgeschlagen, die Frage qualitativ zu verstehen: «Auf welche Weise sind Sie intelligent?» Die Lesenden werden merken, dass diese Betrachtungsweise in die Freiheit führt, jene hingegen tendenziell in die Verkrampfung. Wird die Frage neu gestellt, zeigt sich sofort, dass Intelligenz wenig mit Schulkarriere oder Universitätsabschluss zu tun hat.
Was ist Intelligenz?
Darüber, was Intelligenz ist, lässt sich trefflich streiten. Es ist hilfreich, zwei Haupttendenzen in der Erklärung zu unterscheiden: das eher populäre und das wissenschaftliche Konzept.
Eine Intelligenz
Intelligenz ist ein nahezu ausschliesslich intellektuelles Vermögen, das sich im Umgang mit abstrakten Inhalten zeigt, die von einem intelligenten Individuum verstanden, verarbeitet und formuliert werden. Diese Intelligenz zeigt sich in Tests und lässt sich mit einem Quotienten (IQ) quantifizieren.
Mehrere Intelligenzen
Intelligenz gibt es nicht als eindimensionale Grösse, sondern sie wird als mehrdimensionales Konzept formuliert. Dieses umfasst sowohl die «Fähigkeit des Individuums, anschaulich oder abstrakt in sprachlichen, numerischen und raum-zeitlichen Beziehungen zu denken» als auch die «erfolgreiche Bewältigung vieler komplexer und mithilfe jeweils besonderer Fähigkeitsgruppen auch ganz spezifischer Situationen und Aufgaben», so der Münchner Psychologieprofessor Kurt A. Heller.
Das Konzept a.) entspricht der populären Auffassung von Intelligenz, die häufig mit einer gewissen Ehrfurcht einhergeht, sich vom hohen IQ eines Menschen beeindrucken lässt und sich über einen unterdurchschnittlichen IQ vielleicht noch lustig macht. Dieser undifferenzierte Intelligenzbegriff hat im Normalfall keine Mühe damit, Erfolg in unseren Bildungseinrichtungen mit «Intelligenz» gleichzusetzen: Je intelligenter ein Mensch ist, desto weiter kommt er in Schulen und Universitäten, und umgekehrt.
Konzept b.) resultiert aus einer wissenschaftlichen Vorsicht im Umgang mit dem Intelligenzbegriff. Die Vorsichtigen unterscheiden zwischen objektivierbaren, das heisst beobachtbaren Anteilen – also den Ergebnissen «intelligenten» Handelns – und einer hypothetischen Vorstellung davon, wie man sich die zugrunde liegenden mentalen Prozesse denken könnte.
Multiple Intelligenz
Intelligenz nicht als eine einzelne Fähigkeit, sondern als ein ganzes Bündel mehrerer und voneinander unabhängiger geistiger Vermögen verstehen – diesen Ansatz vertritt auch der Professor für Psychologie und Neurologie an der Universität Boston, Howard Gardner. Als er 1983 sein grundlegendes Werk «Frames of Mind» veröffentlichte, war er damit nicht der erste Psychologe überhaupt; allerdings war er vermutlich der Erste, dem sein Intelligenzkonzept gewissermassen aus den Händen gerissen wurde, speziell im nordamerikanischen und angelsächsischen Raum. Ohne seine Absicht wurde der Ansatz der «Multiple Intelligences» zur Grundlage für einen breiten Strom von Neuerungen in zahlreichen Bildungseinrichtungen weltweit. Dieser Boom hängt wesentlich mit einem auch bei uns spürbaren Missbehagen gegenüber dem überkommenen populären Intelligenzbegriff zusammen, der einseitig intellektualistisch ausgerichtet ist, kognitive Kunststücke überbewertet und nicht in der Lage ist, anderes und ganzheitliches intelligentes Verhalten auch als solches wahrzunehmen.
Das Konzept der multiplen Intelligenz(en) ist ein Ansatz unter mehreren möglichen, die den Intelligenzbegriff auf eine breitere Basis stellen. Es führt dazu, nicht nur die üblichen intellektuell-logisch-abstrakt-kognitiven Aspekte «intelligent» zu nennen, sondern auch andere ganzheitliche personale Begabungen oder Vermögen eines Menschen. Es wird von daher jedem Individuum in der speziellen Verteilung und Weite seiner Fähigkeiten besser gerecht als das traditionelle Konzept.